| Artikelnummer | 9781158901586 |
|---|---|
| Produkttyp | Buch |
| Preis | 21,90 CHF |
| Verfügbarkeit | Lieferbar |
| Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
| Meldetext | Folgt in ca. 5 Arbeitstagen |
| Autor | Books LLC |
| Verlag | Books LLC, Reference Series |
| Weight | 0,0 |
| Erscheinungsjahr | 20130411 |
| Seitenangabe | 28 |
| Sprache | ger |
| Anzahl der Bewertungen | 0 |
Archäologischer Fund (Dänemark) Buchkatalog
Quelle: Wikipedia. Seiten: 28. Kapitel: Goldhörner von Gallehus, Grauballe-Mann, Frau von Haraldskær, Kessel von Gundestrup, Frau von Huldremose, Hjortspringboot, Mädchen von Egtved, Ladbyschiff, Nydam-Schiff, Mann von Borremose, Tollund-Mann, Sonnenwagen von Trundholm, Frau von Elling, Münzfund von Sandur, Frau von Borremose, Moorleiche Borremose II, Frau von Koelbjerg, Mann von Porsmose, Goldfund vom Borgbjerg, Frau von Skrydstrup, Frau von Stidsholt, Luren von Brudevælte, Sædingestein, Brakteat Seeland-II-C, Guldgubber aus Sorte Muld, Goldboote vom Thorshøj, Engelstrupstenen, Steinschale von Ørslev. Auszug: Die Goldhörner von Gallehus waren zwei aus Gold gefertigte Trink- oder Blashörner, die 1639 bzw. 1734 in Gallehus in der Nähe von Tondern im Süden Jütlands gefunden worden sind. Datiert werden sie in die Zeit um 400 n. Chr. (germanische Eisenzeit) und sind die berühmtesten archäologischen Funde Dänemarks. Auf ihnen befindet sich eine frühe Runeninschrift in nordwestgermanischer Sprache. Die kostbaren Hörner erlangten wegen der rätselhaften Bildmotive sowie der für die germanischen Sprachwissenschaften wertvollen Runeninschrift auf dem kürzeren Horn eine große Bekanntheit. Im Jahr 1802 wurden die Hörner vom Goldschmied und Uhrmacher Niels Heidenreich gestohlen und eingeschmolzen. Sie sind heute nur durch Zeichnungen (Stiche) und Beschreibungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert bekannt. Bereits kurz nach dem Diebstahl entstanden Nachbildungen der Hörner, allerdings nicht aus Massivgold, wie die Originale, sondern aus Blattgold auf Silberbasis. Diese Kopien wurden im September 2007 aus dem Nationalmuseum in Jelling ebenfalls entwendet, zwei Tage nach dem Diebstahl aber wiedergefunden. Das längere Horn wurde am 20. Juli 1639 zufällig von einer Klöpplerin namens Kirsten Svendsdatter in Gallehus bei Møgeltønder entdeckt. Später schenkte es der König Christian IV. seinem Sohn Christian. Es wurde restauriert und gelangte in die königliche Kunstkammer. Die wichtigste Beschreibung des längeren Horns liefert der universalgelehrte Altertumsforscher Olaus Wormius 1641 in einer Abhandlung mit dem Titel De aureo cornu, die auch einen Kupferstich von Simon de Pas beinhaltet. Das Horn maß ca. 52 cm in der Länge, ca. 71 cm dem Unterlauf entlang, hatte einen Durchmesser von ca. 10 cm bei der Öffnung und wog ca. 3, 1 kg. Das kürzere Horn fand der Bauer Erich Lassen am 21. April 1734 in der unmittelbaren Nähe des ersten Fundortes. Die Forschung stützt sich hier auf den Bericht des Archivars Joachim Richard Paulli von 1734. Die genauen Maße des kurzen Horns sind unbekannt, man weiß aber, da
21,90 CHF
Lieferbar

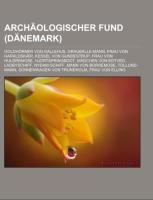
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.